
In der Einsamkeit ist alles verbunden
In der Einsamkeit ist alles verbunden
Während eines Retreats im Winter 2024/25 wohnte ich einer Lesung mit Kommentar von OM C. Parkin bei zu dem Buch von Ramana Maharshi „Die Suche nach dem Selbst“1. Das dabei beleuchtete Thema ‚Einsamkeit‘ aus Sicht der inneren Lehre berührte einen feinen Ort in mir, während ich das Gehörte empfing. Es wirkte in der folgenden Zeit nach, sank tiefer und tiefer, und inspirierte mich die wirkliche Dimension von Einsamkeit näher anzusehen.
Die Aussage des Titels dieses Artikels erscheint auf den ersten Blick verwirrend und paradox. Was verstehen wir eigentlich unter Einsamkeit? Wird in alltäglichen Berichten in den Medien über Einsamkeit gesprochen, ist das Verständnis darüber im allgemeinen Sprachgebrauch auf physisches Alleinsein reduziert. Mit einem Unterton von mitleidigem Bedauern wird Menschen, die – körperlich – alleine sind, oft unhinterfragt ein Verlassenheitsgefühl unterstellt aufgrund von Abwesenheit von Gesellschaft. Erinnern wir uns an die Zeit während der Corona-Pandemie, in der der Begriff unisono täglich fast hysterisch in den Medien von Politikern und Journalisten überbemüht wurde.
Die Fähigkeit des Alleinseins, die in früheren Zeiten und Kulturen Zeichen der Reife war – selbst, wenn man noch nicht mal die spirituelle Ebene betrachtet – wird heute fast als ein Abweichen von der sozialen Norm angesehen und ist gewichen dem fast zwanghaften Versuch, alles dafür zu tun, um Alleinsein gar nicht erst zuzulassen.
In der Einsamkeit, im Alleinsein, empfinden wir jedes Gefühl intensiver, was uns auch unserer Angst und unseren Dämonen begegnen lässt, andererseits aber den Weg dafür öffnen kann uns zu erkennen, auf den Grund unseres Ichs zu gehen.
„Was bedeutet inneres Alleinsein?
Du bist bereit dich der Liebe im Innen zuzuwenden anstatt im Außen.
Und du bist jederzeit bereit dafür, vom Außen verlassen zu werden.“
OM C. Parkin
In unserer heutigen westlichen (Un-)Kultur des (falschen) Hedonismus gilt es fast schon als selbstverständlich, Unangenehmes als nicht normal zu empfinden. Durch ständiges „Tanzen auf allen Hochzeiten“ wird versucht unerwünschte Gefühle, verbunden mit dem Einsamsein, zu vermeiden. Die digitalisierte Welt verstärkt dies durch eine Art dauerndes „Angeleintsein“ – wie durch eine unsichtbare Nabelschnur –, das dann noch als eine Form der Geborgenheit verkauft wird. Die ständige Erreichbarkeit erscheint in großen Teilen der Bevölkerung als so selbstverständlich, dass jemand, der dies nicht pflegt, gar als Ignorant gesehen wird. Die ununterbrochene, äußere Verbundenheit scheint jedoch das Gegenteil zu bewirken von dem, wofür sie den Menschen vorgibt zu dienen.
„Weltweit bezeichnen sich so viele Menschen als einsam, dass in manchen Ländern bereits Einsamkeitsministerien gegründet wurden“, schreibt die Wochenzeitung DIE ZEIT in einem Artikel vom 13. Februar 2025. Die Vorstellung, der „Einsamkeit“ gar politisch entgegenwirken zu können, treibt mitunter seltsame Blüten. In Berlin wurde vor einem Bezirksrathaus eine Quasseltreff-Bank aufgestellt, eingerichtet von der dortigen Bürgermeisterin und der von der Bundesregierung eingesetzten Einsamkeitsbeauftragten (!). Die Autorin des Artikels schreibt dazu: „… kein Ort besser geeignet ist, (…) den rührend hilflosen Aktionismus politischer Einsamkeitsbewältigung zu symbolisieren.“ Sozialwissenschaftler messen gar Einsamkeit quantitativ mit Instrumenten, denen sie hochtrabende Fachbegriffe geben, denen lediglich Befragungen von Menschen nach der Häufigkeit ihres Einsamkeitsgefühls zugrunde liegen.
Vor dem Hintergrund dieses verzerrten Verständnisses von Einsamkeit als defizitäre Daseinsform haben mich die Worte in den Zitaten Ramanas über Einsamkeit aus Sicht der Inneren Lehren und OMs Ausführungen dazu regelrecht elektrisiert. Ich hatte Einsamkeit als wesentlichen und unabdingbaren Schlüssel auf meinem inneren Weg erkannt. Bei der weiteren Lektüre von Werken vieler Weisheitslehrer und Mystiker finde ich Worte, die mich tiefer eintauchen lassen in die wahre, innere Bedeutung von Einsamkeit, sie lassen mir Einsamkeit zum Sehnsuchtsort werden.
In allen spirituellen Kulturen der Welt folgten Eremiten dem Konzept von Einsamkeit als einer Form des Bei-Sich-Seins und der Nichtkommunikation mit der äußeren Welt. Etymologisch stammt das Wort ‚Eremit‘ aus dem Altgriechischen, eremites bedeutet Wüstenbewohner, eremos einsam, unbewohnt. Doch unbewohnt wovon, von wem? Diese Frage scheint eine Spur zu sein zu der inneren Bedeutung von Einsamkeit. Die deutsche Sprache verwendet auch den Begriff ‚Einsiedler‘ für Eremit, Einsiedeln als ein In-sich-selbst-Einsiedeln. „Erst im Einswerden mit dem SELBST erscheint der innere Lehrer unmissverständlich und in seiner reinen Form, ohne seinen Doppelgänger, den Ich-Geist.“2 Dieses Zitat von OM C. Parkin öffnet das Verständnis für die Bedeutung von Einsamkeit in der Weisheitslehre.
„(…) die ursprüngliche und authentische Form dieses Begriffs nicht das ist, was wir gewöhnlich darunter verstehen. Einsamkeit wurde (…) beschrieben [in dem oben erwähnten Buch von Ramana Maharshi] als der natürliche Zustand des EinsSeins im Menschen. Um diesen Zustand zu realisieren braucht es eine vollständige Form der Entsagung. All das Überflüssige, in dem der Mensch lebt, das seinen Zustand des Nicht-Seins ausmacht, ist gekennzeichnet nicht durch Formen der Einheit, des EinsSeins, geschweige denn des Nicht-Zweiseins, sondern ist ausschließlich gekennzeichnet durch Formen der Zweiheit. Keine Ein-samkeit, sondern Zwei-samkeit ist der Zustand des Menschen; auch dann noch, wenn er körperlich alleine ist.“3
In diesem Zitat betont OM C. Parkin die Notwendigkeit von Entsagung, Sannyasa, um in die wahre, innere Einsamkeit zu gelangen, um EinsSein zu erlangen. Er attestiert der gesamten Menschheit ein dauerndes Zuviel an geistiger und körperlicher Bewegung, an Überproduktion eines Geistes, der an ständige Unterhaltung gewohnt ist. Unser Geist nutzt selbst spirituelle Erfahrungen als eine Form der Selbstunterhaltung und wähnt sich dabei schon spirituell gereift. Ich kann aus eigenem Erleben bezeugen, wie schnell sich mein Geist, selbst nach einer tiefen, inneren Erfahrung, das – in einem Augenblick kurzen Aufleuchtens – Erkannte greift und damit „zugange“ ist.
OM führt dazu weiter aus: „Die Evolution des Bewusstseins kann nur geschehen, wenn ich durch das Prinzip der Entsagung gehe. Ich verzichte auf jede Form der falschen Fülle, die sich durch ständige innere Stimulation in mir breit macht. Das ist kein (…) Überfluss von Liebe, Überfluss von Kraft, Überfluss von Leben. Das ist Überfluss des Unwesentlichen, Überfluss von Falschheit, Überfluss des Unnötigen.“
Vom „Leben des „Unnotwendigen“ spricht George Iwanowitsch Gurdjieff in seiner Schule des Vierten Weges in seiner Definition von Sünde, er benennt das Unnotwendige als ein Synonym für alles, was nicht IST. In folgendem Zitat gibt er konkrete Beispiele für dieses Zuviel an allem: „Tatsache ist, dass wir viel zu viel reden. Wenn wir uns auf das beschränkten, was wirklich notwendig ist, würde dies allein schon Schweigen bedeuten. Und so verhält es sich mit allem anderen, mit dem Essen, mit den Vergnügungen, mit dem Schlafen; bei allem gibt es eine Grenze des Notwendigen.“ 4
Der indische Dichter und Philosoph Shankara (686-718 n. Chr.), einer der bedeutendsten geistigen Lehrer des alten Indien, verdeutlicht dies, hinein bis in die höchsten Ebenen, in seinem klassischen Weisheitstext „Das Kleinod der Unterscheidung“: „Entsagung ist Aufgabe aller Freuden des Auges, des Ohres und der anderen Sinne, der Verzicht auf alle Gegenstände vorübergehender Freude, das Aufgeben des Wunsches sowohl nach einem irdischen Körper wie nach der höchsten Art eines göttlichen Geistesleibes.“ 5 Shankara fordert in seinen Worten radikale Entsagung, Entsagung in seiner umfassendsten Art.
So gibt auch das folgende Zitat von OM C. Parkin umfassenden Verzicht als unabdingbares Prinzip des Erreichens von Einsamkeit, von EinsSein wieder: „Ein Mensch, der nicht in Verzicht lebt, lebt in Wünschen, die dem Verzicht gegenüberstehen und Verzicht unmöglich machen. Wenn er dann mit diesen Wünschen auf einen spirituellen Weg gerät, mag in ihm der Wunsch zu verzichten in Erscheinung treten. Wenn er zunächst Wünsche des Nicht-Verzichtes lebte und diese dann durch den Wunsch nach Verzicht austauscht, so mag es für ihn so erscheinen, als sei ein Fortschritt geschehen. (…) der Verzicht, um den es hier geht, ist weitaus umfangreicher als das, was dieser Geist zunächst erfasst. Es geht ja offenbar um den Verzicht des Wünschens an sich. (…) Die Entsagung, um die es wirklich geht, ist vollständiger Natur. Sannyasa, Entsagung, das ganze Streben ist auf die Einswerdung mit Gott gerichtet.“ 6
Bei dem Mystiker Meister Eckhart findet sich der Begriff „Ledigwerden“, der dem, was Entsagung meint, doch sehr nahekommt. Eckhart spricht in Texten, die in dem Buch: „Alles Lassen – Einswerden“ zusammengestellt sind, von der „Abgeschiedenheit, (…) dass der Mensch ledig werde seiner selbst und aller Dinge“, und weiter „(…) dass der Mensch aus dem Seinen ausgeht, ebendort muss Gott notwendig wieder eingehen.“ 7 Allein schon aus dem Titel dieses Buches, Alles Lassen – Einswerden, lässt sich die wahre innere Bedeutung von Einsamkeit lesen.
Als ich in der eingangs erwähnten Veranstaltung OMs Worte zur wahren, inneren Bedeutung von Einsamkeit empfing, erlebte ich mehr und mehr ein Fallen bis auf einen Grund des Nichtwissens. Alles Verstehen-Wollen konnte aufhören, es war direktes Erfahren eines Momentes von ‚Entsagung‘. Alle Konzepte, die mein Verstand andernfalls sogleich erstellt, fielen in mir für einen Augenblick in sich zusammen. Entsagung, Verzicht, erfordert von uns Menschen das Aufgeben aller Wünsche – bewussten wie auch verborgenen Wünschen. In dem Moment, in dem wir etwas wünschen, treten wir aus dem EinsSein wieder heraus. Verzicht jedoch hinterlässt in uns Menschen oft ein Gefühl öder, unangenehmer innerer Leere, die wir glauben, möglichst schnell wieder füllen zu müssen, künstlich, durch allerlei Arten von Ablenkungen und Bewegungen auf allen Ebenen. Auf dem inneren Weg erleben wir immer wieder Phasen der Ödnis, in denen wir uns haltlos, unruhig, verunsichert, wie aus der Bahn geworfen fühlen. Es sind Zustände, die uns „Angst machen“ – wir möchten ihnen so schnell wie möglich entkommen. OM stellt uns vor die Frage, was dadurch eigentlich abgewehrt werden soll: „Es ist der Unwille, der sich gegen das Innen richtet, der Unwille, der sich gegen die Stille richtet, es ist das Nein gegen das, was ist. Ständige Überbewegung im Geiste und im Leben als ein Nein zur Stille.“
Er verweist auf den Ort der Wüste, den die Wüstenväter einst aufsuchten und an den die Meister in früheren Zeiten ihre Schüler schickten. Die Wüste kann für uns symbolisch stehen für einen Zustand, in dem es keine Ablenkung, keinerlei Unterhaltung gibt – für einen Ort der Stille. Einerseits sehnen wir in der lauten Welt die Stille oft herbei, doch sie dann wirklich auszuhalten fällt uns schwer. Schnell flüchten wir wieder in äußeres Tun oder in mentale Bewegungen, um die innere Stille abzuwehren. Der Zustand, wenn „nichts ist“, erscheint uns als unerträglich, als tot. Wir assoziieren Stille mit dem Tod.
„Das ist der Grund dafür, warum die Menschen ein künstliches Leben führen. Sie (…) produzieren sich selbst (…) künstlich in ihrem Geiste, um am Leben zu bleiben, erschaffen ständig künstliche Lebendigkeit, um dem Tod zu entkommen. All das entspricht nicht der Anweisung der Entsagung. Entsagung kann vorübergehend in das Tote führen, das wir selbst hinterlassen haben durch künstliche Überproduktion von Gedanken, Bildern und Welten.“
Dass das ständige Überproduzieren, das Zuviel an allem, ein künstliches Leben ist, wie OM es in diesem Zitat nennt, darüber herrscht oft nicht einmal Bewusstheit. Die Stille steigert die Intensität unseres inneren Erlebens, und diese Intensität, die in der Einsamkeit, im Alleinsein erfahrbar ist, wird versucht zu vermeiden durch Ausweichbewegungen des menschlichen Geistes und Tuns. Doch es bleibt uns nur, die Leere zu durchqueren; ihr auszuweichen generiert immer noch weitere Angst, der wir wiederum zu entfliehen versuchen. Es führt zu einem Teufelskreis.
„(…) dass Stille lebendig sein kann und dass sich in dieser Stille alles manifestieren kann, das ist erst eine Folge davon, dass wir bereit gewesen sind durch die Ödnis zu gehen, durch die Langeweile. Dass wir bereit sind auszuhalten, weiterzugehen und dann in der wirklichen Stille landen, die nicht tot ist. Die Stille enthält das Prinzip des Lebens wie das des Todes. Stille ist das letzte Prinzip – jenseits von Polaritäten. (…) Wir müssen uns jenem Teil in uns widmen, der einen Kampf gegen die Stille führt.“
An dieser Stelle möchte ich aber auch ein Beispiel erwähnen, das zeigt, dass gleichzeitig zu den dargestellten Vermeidungsstrategien von Einsamkeit das Bedürfnis nach – zumindest zeitweisem – Rückzug in die Stille und Abgeschiedenheit klösterlichen Lebens wieder mehr und mehr als ein hohes Gut gesucht und erkannt wird.
Mir fiel ein Büchlein in die Hand einer italienischen Stadteremitin und modernen Mystikerin, Antonella Lumini, die mitten im touristischen Zentrum von Florenz eine sogenannte ‚Pustinia‘ (russisch; Wüste) eingerichtet hat, in der Menschen zu Einkehr, Meditation, Zusammensein in Stille eingeladen sind. Angeregt wurde sie von Catherine de Hueck Dohertys8 Madonna House in Kanada. In deren russischer Heimat gab es die Tradition der Pustinia, ein Ort des Rückzugs in die Stille. Diese hatte aber bald erkannt, dass äußere Einsamkeit nicht selbstverständlich in die Stille führt, dass es nicht genügt, sich aus der Welt mit ihren Gütern zurückzuziehen, sondern dass die Stille zu einer inneren Haltung heranreifen muss. So begann sie die Wüste in der Großstadt, die Stille in der lauten Welt zu leben. Antonella Lumini schreibt in ihrem Büchlein „Hüterin der Stille“: „Die Einsamkeit wird zum Zentrum einer Präsenz, die alles umfasst.“ 9
Diesem Satz zu lauschen, ihn nach innen sinken zu lassen, führt alle zentrifugalen (Schein-)Kräfte, die im alltäglichen Leben ständig in uns wirken, zurück in die Mitte – zurück ins EinsSein.
Auch Ramana Maharshi betont in seinem Buch „Die Suche nach dem Selbst“, wie wenig Weltflucht ein Garant für innere Stille ist: „Die Einsamkeit ist im Geist des Menschen. Man kann mitten in der Welt sein und den Frieden des Geistes wahren. Solch ein Mensch ist einsam. Ein anderer mag im Walde leben, aber unfähig zur Kontrolle seines Geistes sein. Ihn kann man nicht einsam nennen. Einsamkeit ist eine Geisteshaltung, ein Mensch, der an Wünschen hängt, findet keine Einsamkeit, wo er auch immer sein mag. Der Losgelöste hingegen ist immer einsam.“
Ein Verständnis von Alleinsein, von wirklichem Allein-Sein, gegründet in der Stille, öffnet der englische Sufi-Lehrer und Mystiker Llewellyn Vaughan-Lee10 in seinem Buch „Fragmente einer Liebesgeschichte“, in dem er eigene Erfahrungen seines mystischen Pfades wiedergibt: „Ich wollte immer in die Einheit zurückkehren, die alles umfasst, in der alles von Liebe durchtränkt ist. Und stattdessen fand ich eine Einheit, die in meinem Alleinsein beheimatet, die in ihrer eigenen Achse der Wahrheit gegenwärtig ist. Und ich habe dafür einen bestimmten Traum aufgeben müssen (…) Vor der Morgendämmerung gibt es immer einen Wolkenschleier, der die Sonne bedeckt, eine Dunkelheit, die da ist. Und manchmal sind es unsere tiefsten Wünsche, unsere Sehnsüchte, die diese Wolke schaffen, und auch sie müssen zurückgelassen werden.“ 11
„Da ist niemand sonst. Du bist immer allein gewesen, aber du dachtest, das wäre ein Zustand der Unvollständigkeit. Du hast darauf gewartet, dass jemand kommt. Wie kann es jemand anderen geben, wenn Er eins ist? (…) Mit wem kannst du sprechen, wenn es keinen anderen gibt? Mit wem kannst du in Beziehung treten? (…) Du bist gesegnet, keinen Mitspieler zu haben – stehst an der Bushaltestelle und wartest ewig auf den Bus, der nie kommt, weil es nichts gibt, wo du hinreisen könntest.“ 12
In der Einsamkeit ist alles verbunden. Wahre Einsamkeit, EinsSein ist Vereinigung mit dem SEIN.
______________________________________________________________________
1 Lesung und Kommentar von OM C. Parkin am 30.12.2024, Kloster Gut Saunstorf,
Ramana Maharshi, Die Suche nach dem Selbst, advaitaMedia 2024
2 Aus: „Was ist Erwachen?“ / Gespräch mit OM C. Parkin am 2. Januar 2016 im Kloster Gut Saunstorf, OM C. Parkin / Artikel, advaitaMedia Online-Shop
3 Aus: Lesung und Kommentar von OM C. Parkin am 30.12.2024, s.o.
4 P. D. Ouspensky, Auf der Suche nach dem Wunderbaren – Perspektiven der Welterfahrung und der Selbsterkenntnis nach G. I. Gurdjieff, advaitaMedia 2024, S. 564 f.
5 Shankara, Das Kleinod der Unterscheidung – und – Die Erkenntnis der Wahrheit, advaitaMedia 2023, S. 46
6 Aus: Darshan mit OM C. Parkin am 29.12. 24 II, Kloster Gut Saunstorf
7 Meister Eckhart: Alles lassen – Eins werden, Mystische Texte – Reden der Unterscheidung und Predigten, Kösel-Verlag S. 42 und S. 92
8 Catherine de Hueck Doherty (geb. 1896 in Russland, gest. 1985 in Kanada), floh während der russischen Revolution nach Kanada; nach schmerzhaften, entbehrungsreichen Jahren dort gründete sie 1957 das Madonna-House von Winslow. Sie stand für eine im Körper verankerte Spiritualität, hatte die Verkopfung der Westmenschen erkannt. So entstand dort die Idee des Wirkens auf dem „Marktplatz“, einer Pustinia der Liebe und Hingabe, in dem Männer und Frauen als „kontemplative Präsenz“ arbeiteten.
9 Antonella Lumini, Paolo Rodari: Hüterin der Stille – Mein Leben als Stadteremitin in Florenz, Edition Spuren 2020, S. 141
10 Llewellyn Vaughan-Lee, Schüler und Nachfolger von Irena Tweedie; Sufilehrer des Naqshbandiyya-Mujaddidiyya-Sufi-Ordens, Gründer des Golden Sufi Centers in Nordkalifornien; die Naqshbandi-Sufis praktizieren einen stillen Dhikr (die stille Meditation des Herzens)
11 Llewellyn Vaughan-Lee, Fragmente einer Liebesgeschichte – Betrachtungen über das Leben eines Mystikers, Oneness Center Publishing 2012, S. 98
12 Llewellyn Vaughan-Lee, Fragmente einer Liebesgeschichte, S. 66 f.
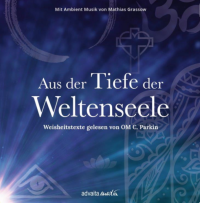 Bleib in Kontakt
Bleib in Kontakt